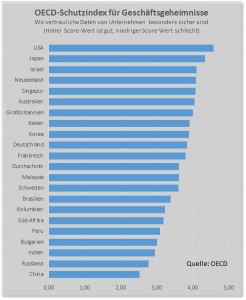Beschwichtigungen allerorten. „Kein Grund zur Panik!“, mahnen die Ökonomen. Von einer Stimmungseintrübung könne „keine Rede“ sein, ebenso wenig von einer sich ankündigenden „Eiszeit“. Man dürfe den Indexrückgang „nicht überbewerten“. Allenfalls eine „Verschnaufpause“ sei nun zu erwarten angesichts des bereits recht reifen Stadiums im Wachstumszyklus der deutschen Wirtschaft. Die zitierten Äußerungen sind eine Reaktion auf den Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex von 111,3 auf 110,7 Punkte, der nach Einschätzung der Ifo-Experten in erster Linie die pessimistischere Einschätzung wegen der Krim-Krise widerspiegelt.
Das trotz des Krim-Konflikts nach wie vor recht positive Konjunkturbild der Analysten erklärt sich aus dem recht hohen Niveau, auf dem sich die Wirtschaftsaktivitäten in Deutschland derzeit noch befinden. Die binnenwirtschaftlichen Wachstumstreiber Privatkonsum und Investitionen sind nach wie vor intakt, weil sie von niedrigerer Arbeitslosigkeit, steigenden Einkommen und den Modernisierungsnotwendigkeiten der Unternehmen gespeist werden. Auch die Exportaussichten sind wegen des Produktmix deutscher Unternehmen weiterhin positiv, auch wenn in Asien erste Ermüdungserscheinungen auftreten und der Euro-Währungskurs die preisliche Wettbewerbsfähigkeit etwas schmälert.
Was in der Prognose der künftigen konjunkturellen Entwicklung dabei vollkommen unterschätzt wird, ist die tektonische Verschiebung, die mit dem geopolitischen Konflikt eingesetzt hat. Die Kapitalflucht, die derzeit in Russland registriert wird, ist nur der Start einer generellen Umorientierung im Welthandel. Und dies wird vor allem die in Russland extrem engagierten deutschen Unternehmen treffen. Da braucht es gar keine weiteren Sanktionen mehr. Das Grundvertrauen der Investoren ist schon jetzt erschüttert. Wer will unter diesen Umständen in einem solchen Land und seinen Anrainern noch guten Gewissens investieren? Zumal dem Vernehmen nach in Russland bereits ein Gesetz in Vorbereitung ist, das Enteignungen und Verstaatlichungen von Unternehmen vereinfachen soll. Die absehbare Umorientierung von Investitionsströmen, die viele Milliardenengagements entwerten wird, und die Neuausrichtung des Außenhandels werden eine Zeit der Unsicherheit mit sich bringen, die in den Staatshaushalten ihren Niederschlag finden wird und in den Unternehmensbilanzen.
Nun wenden viele Beobachter ein, dass von den deutschen Exporten nur etwa 3 % nach Russland und nur 0,5 % in die Ukraine gehen, ein Einbruch also locker wegzustecken wäre, zumal die Erschütterungen wegen des Eigeninteresses der russischen Wirtschaft ja nur vorübergehend sein dürften. Auch über den Kanal steigender Energiepreise sei kein Effekt auf die deutsche Konjunktur zu erwarten, sofern drastischere Wirtschaftssanktionen ausbleiben. Doch wird dabei unterschätzt, dass die Folgen solcher geopolitischen Entwicklungen nie auf bilaterale Einzelbetrachtungen beschränkt bleiben. Wie Schockwellen durchdringen sie viele andere Bereiche, die scheinbar nichts damit zu tun haben. Erst vor kurzem hat die Ratingagentur Moody’s vor der Verwundbarkeit vieler Emerging-Markets-Länder gewarnt wegen ihrer zu hohen Abhängigkeit von externen Investitionen und den Kapitalflüssen. Eine kleine Störung kann hier schon größere Folgen nach sich ziehen. Und die Eurokrisenländer sind auch noch nicht aus dem Gröbsten heraus. Stockt die deutsche Konjunktur oder trübt sich der Welthandel ein, fallen sie erneut in die Rezession.
Schon in der Vergangenheit haben viele Ökonomen die Ansteckungsgefahren solcher geopolitischen Krisen unterschätzt, weil sie ihr Urteil viel zu sehr auf die lokalen und in den Wirtschaftsstatistiken unmittelbar sichtbaren Zusammenhänge abgestellt haben. Psychologische Effekte und die Wirkungen informellen Herdenverhaltens aufgrund beunruhigender Nachrichten wurden verkannt. Auch die Marktakteure scheinen den Ernst der Lage noch nicht begriffen zu haben.
Es geht nicht darum, einem konjunkturellen Doomsday-Szenario das Wort zu reden. Davon sind wir noch weit entfernt. Doch ein nicht durch Gesundbeterei getrübter Blick würde dazu zwingen, die politische Neuorientierung des Westens ökonomisch zu begleiten und erkannte Risiken schon im Vorfeld anzugehen. Denn richtig gefährlich wird die Lage nur, wenn man wegen der analytischen Scheuklappen blind in die nächste Rezession stolpert – und dann durch aktionistisches Getue alles nur noch schlimmer macht.
(Börsen-Zeitung, 26.3.2014)