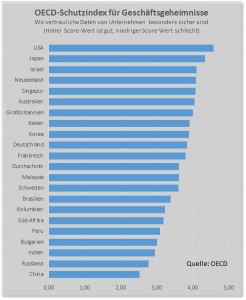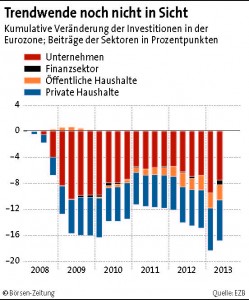Wie morsch das Gebälk der Demokratie in einigen Staaten der westlichen Welt inzwischen geworden ist, zeigt eine neue Veröffentlichung zu den Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA und seinem britischen Gegenstück GCHQ. Heise-Online berichtete mit Verweis auf einer neuen Enthüllung des US-TV-Senders NBC, dass die eigentlich demokratischen Werten verpflichteten Regierungsstellen in den genannten Ländern weit über „Horch & Guck“ hinausgehen. Sie beobachten also nicht nur, verknüpfen die Informationen und geben sie dann gewissermaßen veredelt weiter zum Vorteil ihrer jeweiligen Regierung, sondern greifen aktiv in die Datenstrukturen und den Internet-Verkehr ein, verunglimpfen Personen, machen sie mundtot, verändern Informationen und zerstören Menschen, indem sie ihnen falsche Äußerungen unterschieben sowie einen Verdacht gegen sie in die Welt setzen und diesen dann streuen. Und solche Taktiken werden nicht nur gegen Terroristen und Verbrechersyndikate genutzt, sondern auch gegen – wie auch immer definierte – missliebige Personen, wie es heißt.
Es ist erschreckend und in höchstem Maß verstörend, wie durch solche Handlungen die westliche Demokratie insgesamt desavouiert und von innen heraus zerstört wird. An der Oberfläche sonnt sich US-Präsident Barack Obama noch im Licht der Werte von Freiheit und Demokratie, die als Vorbild für andere Staaten gelten sollen und den dunklen Regimen etwa in Russland und China entgegen gesetzt werden. Doch im Inneren hat die Demontage der Demokratie längst begonnen, wenn der freie Informationsfluss gelenkt, missliebige Personen diskreditiert, den Menschen eine andere Welt vorgespiegelt wird. Was unterscheidet NSA und GCHQ dann noch von der „Stasi“, der Staatssicherheit in der DDR – und so manch dunkler Zukunftsvision aus Science-Fiction-Romanen? Es braucht nur wie in Ungarn ein „Volkstribun“ vom Schlage eines Viktor Orbán „demokratisch“ an die Macht kommen. Mit diesen Beeinflussungsmöglichkeiten versehen, verkommt eine Demokratie dann schnell zur hohlen Phrase.
Umso verstörender ist, dass Politik und Öffentlichkeit diesen Themen so wenig Interesse entgegenbringen. Das steht im krassen Gegensatz zur Selbstgefälligkeit, mit der sich Bürger wie Politiker in der westlichen Welt so gerne als „Demokraten“ begreifen. In allen europäischen Staaten spielt das Thema einer Presseschau zufolge keine große Rolle mehr. Man arrangiert sich, geht zur Tagesordnung über. Es scheint, dass eine gewisse Sättigung erreicht ist. Offenbar wird das Risikopotenzial dieser neu entstandenen Lage nicht erkannt. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage des Allensbacher Meinungsforschungsinstituts. 69 Prozent der Befragten meinen danach, dass die Menschen sich wohl damit abfinden werden, dass ihre persönlichen Daten im Internet nicht sicher sind. 66 Prozent erwarten schlicht, dass Forscher und Wissenschaftler schon neue technische Möglichkeiten entwickeln werden, damit Datenmissbrauch besser unterbunden wird. Dann müsste sich die Politik aber wohl mehr um das Thema kümmern. Gleichzeitig gehen aber 63 Prozent davon aus, dass die Menschen noch mehr persönliche Informationen preisgeben als heute. Sie schätzen sich selbst also so ein. Nur 37 Prozent setzen auf den Staat, dass dieser für einen besseren Schutz für persönliche Daten im Internet schon sorgen wird.
Ist das bereits eine Kapitulation? Es scheint fast so. Und Politik sowie Intellektuelle, die sich sonst bei jedem noch so kleinen Skandälchen aufregen und die Talkshows bevölkern, zeigen sich stoisch und irgendwie desinteressiert. Warum nur?