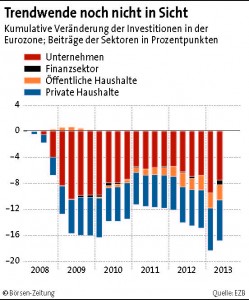Auf die Frage, ob die Eurozone noch in fünf Jahren in ihrer aktuellen Form bestehen wird, davon zeigen sich immerhin knapp 71 % der Teilnehmer des European Banking Congress (EBC) in Frankfurt überzeugt. Aber nur die wenigsten erwarten, dass die Krise bis dahin auch schon überstanden ist. Eine knappe Mehrheit hält die unkonventionellen Bemühungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Wachstumstimulierung zudem für wenig erfolgreich; vier Fünftel glauben, dass die populistischen Parteien in Europa weiteren Zulauf erhalten; und ebenso viele gehen davon aus, dass die Politik sich bis dahin durchwursteln und zu keinem großen Reformakt aufschwingen wird. Das Publikum ist sich zudem einig, dass die Eurozone dafür eigentlich eine Neufassung der EU-Verträge benötigt (66,2 %) und einen eigenen Finanzminister braucht (64,5 %), aber es fehlt der Glaube, dass die Politik das tatsächlich bewerkstelligen kann.
Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zeigt sich im Podiumsgespräch auf dem EBC abgeklärt in seiner Einschätzung über die weitere Entwicklung der Eurozone. Er bekräftigt zwar seine Forderung nach einer Überarbeitung der EU-Verträge, hält dies aber aktuell für nicht mehrheitsfähig. „Wir brauchen dringend Vertragsänderungen“, sagt er. Aber manche Regierung fürchte Vertragsänderungen so sehr „wie der Teufel das Weihwasser“. Derlei tiefgreifende Änderungen seien in der EU nur bei einer weiteren größeren Krise durchsetzbar.
Eine Vertragsänderung ist seiner Meinung nach auch im Falle der europäischen Bankenaufsicht notwendig. Die EZB sei ja nur deshalb mit der Aufsichtsfunktion beauftragt worden, weil sich dies ohne Änderung der EU-Verträge habe durchführen lassen. Die hierdurch entstehenden Interessenkonflikte zwischen Aufsicht und Geldpolitik seien in Kauf genommen worden. Er gesteht aber auch zu, mit der jetzt gefundenen „Übergangslösung“ leben zu können. Damit habe man ja so seine Erfahrungen gemacht, ließ er durchblicken und verwies auf die Zeit bis zum Mauerfall. Es könne dann doch „ganz schnell passieren“.
Die Eurozone zeigt sich nicht nur auf diesem Feld als unvollkommene Währungsunion. Vor allem fehlt es ihr offensichtlich an einer gemeinsamen verantwortlichen Fiskalpolitik als handlungsfähiges Gegenstück zur Geldpolitik. Zugleich herrscht allenthalben Misstrauen der Staaten untereinander. So wird eifersüchtig darüber gewacht, dass kein Mitgliedsland mehr für sich herausholt als andere. Die moralische Versuchung, auf Kosten der Gemeinschaft zu agieren und eigene Lasten dem Kollektiv aufzuhalsen, ist schließlich groß. Und das Misstrauen wächst wegen immer neuer Vorschläge von Regierungen zur Vergemeinschaftung von Haftung. Schäuble attestiert ihnen hierbei „große Kreativität“.
Der Präsident des US-Think-Tank Peterson Institute, Adam S. Posen, sowie der Direktor des Brüsseler Think Tank Bruegel, Guntram B. Wolff, halten Moral Hazard denn auch für eines der größten Risiken der Eurozone überhaupt, weil es Misstrauen säht und die Nationen eher auseinandertreibt. Posen warnt zudem davor, die Unterschiedlichkeit der Staaten zu stark einebnen zu wollen, und Wolff fordert einen neuen „Integrationsschub“.
Schäuble zeigt sich vor diesem Hintergrund überzeugt, dass unter diesen Umständen missliebige Reformen oft nur durch harte Konditionalität etwa von Hilfszusagen durchgesetzt werden können, und spricht dabei von „Peaceful Engineering“. Zugleich dürfe man es nicht bei der Etikettierung neuer Institutionen belassen. Vielmehr müsse etwa auch ein europäischer Finanzminister mit der nötigen Durchsetzungskraft ausgestattet werden, was Schäuble erklärtermaßen unterstützt.
Einen gewissen politischen Realismus legt auch der britische Europaminister David Lidington an den Tag. Er fordert, wie nicht anders zu erwarten, einen Rückbau der Brüsseler Regelungssucht, spricht vom steigenden Frustrationspotenzial in der EU, und wirbt stattdessen für eine Konzentration auf den Binnenmarkt (während er zugleich Einschränkungen bei der Freizügigkeit wegen der Einwanderung in die Sozialsysteme verlangte). Europa müsse letztlich „Wachstum und Jobs liefern“, um sein Dasein zu rechtfertigen. Zugleich zeigte er aber Verständnis dafür, dass für die Eurozonenstaaten eine noch größere Integration überlebenswichtig ist. Dem wolle Großbritannien nicht entgegenstehen.