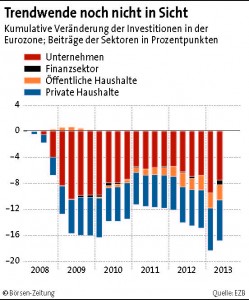In den USA ist eine heiße Debatte über die schädlichen Wirkungen zunehmender wirtschaftlicher Ungleichheit entbrannt. Ökonomen wie der Nobelpreisträger Paul Krugman oder Joseph E. Stiglitz geißeln die enormen Vermögensgewinne, welche die ohnehin bereits Vermögenden auf Kosten der ärmeren Schichten angehäuft hätten. Und der Internationale Währungsfonds (IWF) hat unlängst in einer Studie davor gewarnt, dass Ungleichheit tendenziell auch das Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft schmälert – von der sich aufstauenden Unruhe unter den Verliererschichten ganz zu schweigen. Manche Stimmen sprechen bereits von einer Finanz-Oligarchie, die sich in den USA breitgemacht und sich den Staat untertan gemacht habe.
Wie weit diese Entwicklung in den USA bereits fortgeschritten ist weit jenseits der hinlänglich bekannten reinen Einkommensbetrachtung zeigt eine Statistik der OECD. Dort wird der Anteil jener Haushalte angegeben, welcher innerhalb eines Jahres schon einmal nicht genug Geld für Nahrung hatte: In der Türkei war dies bei 32,7 Prozent der Privathaushalte schon einmal der Fall und in den reichen USA mit 21,1 Prozent ebenfalls überraschend viel. Pikant ist die Aufstellung, wenn man die Länder betrachtet, in denen die Haushalte diesbezüglich bessergestellt sind: in Russland sind es 21,0 Prozent, die sich eine Mahlzeit einmal nicht leisten konnten, und selbst in Griechenland waren es nur 17,9 Prozent. Zum Vergleich: in Deutschland waren es dank unseres Sozialstaats nur 4,6 Prozent. Die Krone wird dieser Betrachtung aufgesetzt, wenn man bedenkt, dass der US-Kongress im Februar beschlossen hatte, die finanzielle Unterstützung für arme Haushalte beim Kauf von Essen (Food Stamps) zu kürzen.
Auch die Einkommensverteilung spricht für sich. Der US-Ökonom J. Bradford Delong kritisiert, dass inzwischen das reichste 1 Prozent der US-Bevölkerung vom Gesamteinkommen ganze 22 Prozent einstreicht; die reichsten 10 Prozent kommen auf mehr als die Hälfte aller Einkommen in den USA überhaupt. Die Einkommen der 10-Prozent-Topverdiener sei inzwischen zwei Drittel höher als das ihrer „Kollegen“ 20 Jahre zuvor.
Vor wenigen Tagen hat die Debatte nun eine neue Schärfe erhalten mit der These, dass die USA von einer freiheitlichen Marktwirtschaft immer mehr in die Rolle einer oligarchisch geführten Autokratie abgleiten. Der französische Ökonom Thomas Pikkety spricht in seinem Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“, das Krugman als „das wichtigste Wirtschaftsbuch womöglich des Jahrzehnts“ hochleben lässt, von großem Reichtum, der sich immer mehr politischen Einfluss kauft und damit die staatliche Regulierung in seinem Sinne lenkt. Viele Konservative, welche dem Staat Grenzen setzen möchten, lebten zudem in einer intellektuellen Blase von Denkfabriken, die von einer Handvoll extrem reicher Geldgeber finanziert würden, kritisiert Pikkety. Er insinuiert damit auch eine gewisse Lenkung der öffentlichen Meinung, die in Gestalt ökonomischer Fakten und wissenschaftlich gesicherter Zusammenhänge daherkommt und als unabhängig deklariert werde. Wie die Lage der meisten Menschen in der Gesellschaft wirklich ist, unter welchen Mühen sie ihren Unterhalt bestreiten muss, das komme bei den Menschen in dieser Blase gar nicht an, schreibt er vorwurfsvoll. Diese Anklage hat in den USA und in den ökonomischen Blogs einen regelrechten Debattensturm entfacht.
Als Beleg für eine von einer (Kapital-)Machtelite gelenkten Politik führen die Ökonomen etwa die steuerliche Begünstigung von Vermögenseinkommen gegenüber den Einkommen abhängig Beschäftigter an. Oder die Rettungspolitik im Nachgang zur Finanzkrise. Auch die ultralockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed, betont etwa Krugman, hätte zusammen mit den Anleihekäufen in diese Richtung gewirkt. Schließlich seien Banken gerettet worden, und zuvorderst würden sie zusammen mit den großen Investoren von dieser Politik profitieren, weil sie kaum Abschreibungen vornehmen müssten. Der international bekannte Wirtschaftshistoriker Harold James verweist auf den Erleichterungsboom, der durch die unkonventionelle Geldpolitik losgetreten worden sei. Von den Kursgewinnen hätte nur eine Minderheit profitiert, die an den Finanzmärkten engagiert sei. Schon jetzt, so Krugman, stelle die Politik die Interessen der Reichen stets über jene der Normalbürger. Überschreite diese Ungleichheit zudem ein gewisses Maß, nähre sie sich stetig selber. Krugman: Reichtum dominiert die Arbeit.
Einen Grund für diese Politik sehen Ökonomen wie Krugman in der Tatsache, dass die handelnden Politiker selbst zu den Top-Vermögenden zu rechnen sind und damit auch Ihresgleichen bevorzugen. 20 Prozent der reichten Amerikaner würden 85 Prozent der Finanzanlagen besitzen. Und fast alle US-Senatoren gehörten schließlich zu den Top-Ein-Prozent der reichsten Amerikaner, weshalb sie ein Interesse hätten, dass die Vermögenseinkommen durch Finanzkrisen oder die Politik eben nicht geschmälert oder gar vernichtet würden.
Derzeit, so befürchten Pikkety, Krugman und Stiglitz verschlimmere sich die Lage noch. Zum einen, weil die Wirtschaft in den Industrieländern insgesamt nicht mehr so schnell wächst, weshalb auch die Entwicklung der Lohneinkommen stets hinter den Vermögenseinkommen hinterherhinken würde. Denn letztere würden weltweit angelegt, wo die Renditen noch höher seien, während die Arbeit lokal verhaftet sei und mit Niedriglohnländern konkurrieren müsse. Zum anderen, weil sich zudem ein aggressiv agierender „Erbkapitalismus“ gebildet hätte, wie Krugman kritisiert.
Denn ein immer größerer Teil der Superreichen hat sein Vermögen inzwischen ererbt. Sechs der zehn reichsten Amerikaner seien Erben und keine Unternehmer aus eigener Kraft, führt er an. Die Kommandobrücken der Wirtschaft würden damit nicht vom Reichtum schlechthin, was schon schlimm genug sei, beherrscht, sondern von ererbtem Reichtum. Und Pikkety schreibt vor diesem Hintergrund: „Die Gefahr einer Entwicklung zur Oligarchie ist real und berechtigt zu wenig Optimismus“.
Das von den zitierten Ökonomen skizzierte Gesellschaftsbild, in dem eine gierige reiche Minderheit sich der Wirtschaftskraft einer ganzen Nation bemächtigt hat, mag überzeichnet sein, viele Aspekte und manche Erfahrungen zeigen, dass zumindest der Versuch im Kapitalismus immanent ist, sich gewisse Vorteile zu erschleichen – über Politik, Institutionen aber auch die öffentliche Meinung. Der Kampf vieler Ökonomen gegen die erdrückende Dominanz des Staats auch in der Wirtschaft, gegen Überregulierung und für Privatisierung mag anfangs berechtigt gewesen sein (und ist es in vielen Bereichen und Staaten immer noch), doch ging dieser weit über das notwendige Maß hinaus, als etwa auch die ordnungssetzende Macht des Staates ebenso zurückgedrängt worden ist. Das hat der Spekulation und verbrecherischen Aktivitäten in der Wirtschaft Raum gegeben und Profite in die Taschen von Falschspielern gelenkt, wie jetzt anhand von vielen Prozessen so nach und nach ans Tageslicht kommt.